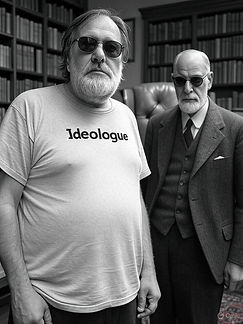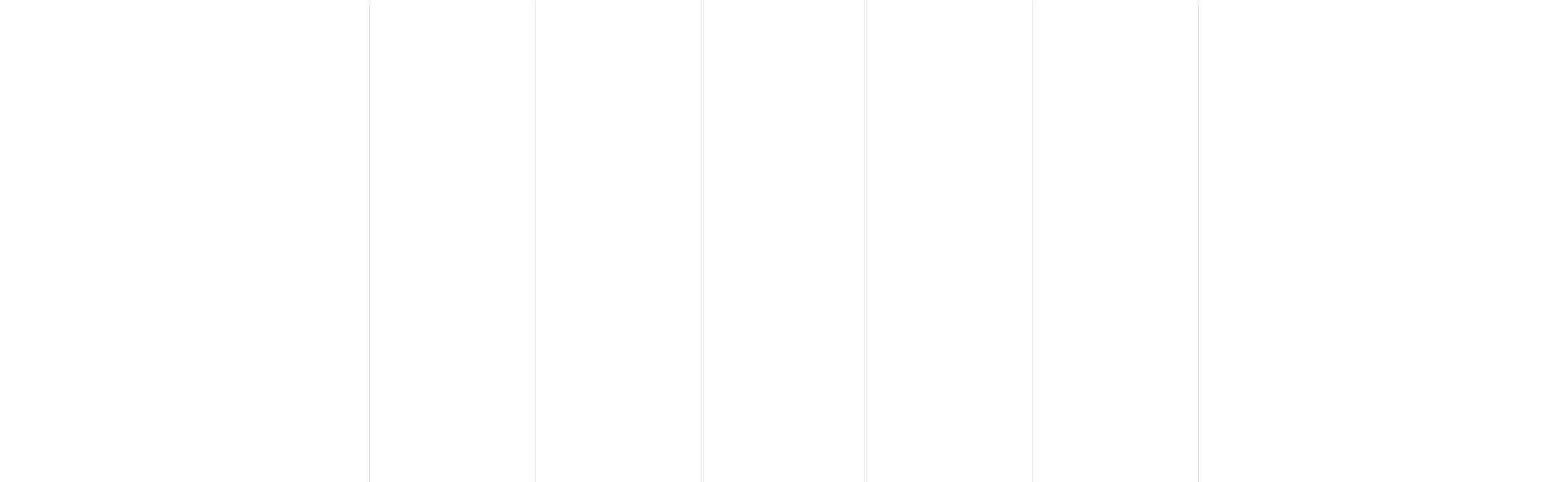
„Es gibt Menschen, die ihre Neurosen lieben.
Sie nennen das dann Psychoanalyse.“
Kurt Tucholsky (1890–1935), Deutscher Satiriker
Advokatus Diaboli
Die Psychoanalyse ist umstritten und das schon seit ihrer Geburt.
Freud?
Ein sexistischer Scharlatan.
Seine Theorien?
Unwissenschaftlich!
Sowieso, geht es bei Freud nur um Sex - Nein. Ausser, Sie hätten vielleicht gerne, dass es so ist?
Psychoanalyse?
Kein Bisschen Lösungsorientiert.
Der Analytiker?
Machtgeil und vernarrt in seine Deutungshoheit.
Anwalt des Teufels
Auf dieser Seite gehe ich auf häufige Einwände gegen Freud und die Psychoanalyse als Methode ein und bin Anklägerin und Verteidigerin zugleich.
Advocatus Diaboli heißt wörtlich „Anwalt des Teufels“ und beschreibt jemanden, der absichtlich die Gegenposition einnimmt, um eine Idee oder Argumente zu hinterfragen – auch wenn er selbst nicht unbedingt dieser Meinung sein muss.
Es geht darum Gedanken kritisch zu prüfen.
Weil es mir FREUD(e) macht
Dabei nehme ich die bedeutungsschwere Psychoanalyse nicht immer ganz so ernst, wie sie sich selbst.
Auf dieser Seite finden Sie also nicht den „Ernst des Lebens“ – sondern einen leichteren Zugang zu Freud & Co.
Zur Auflockerung gibt es KI-Bilder – historisch zweifelhaft, aber unterhaltsam.
Mit dieser Seite möchte ich zeigen, dass man Psychoanalyse weder dogmatisch verteidigen noch pauschal ablehnen muss.
Lesen Sie weiter.
Oder verdrängen Sie es.
Beides ist aufschlussreich…
Hinweis zur Sprache:
Aus stilistischen Gründen verwende ich das generische Maskulinum. Selbstverständlich sind damit alle gemeint.
Und falls Sie eine interessante Kritik haben, schicken Sie mir diese gerne per E-Mail. Vielleicht findet sie hier ihren Platz.

Freud hat Kokain als Therapie empfohlen – vermutlich war er selber drauf, als er die Psychoanalyse entwickelt hat!
Ja, Freud hat mit Kokain experimentiert und es konsumiert – und ja, er hat es eine Zeit lang sogar als Medikament befürwortet. Aber bevor Sie jetzt das Bild von Freud als drogensüchtigem Psycho-Guru im Kopf haben, ein bisschen Kontext:
Kokain als medizinisches Wundermittel
im 19. Jahrhundert wurde Kokain in Europa und Nordamerika zuerst noch als vielseitiges Wundermittel in der Medizin angesehen.
Ärzte, Wissenschaftler und Apotheken priesen es als vielseitig einsetzbares Mittel – gegen Müdigkeit, Schmerzen und Depressionen. Freud war also nicht der Einzige, der sich davon therapeutisches Potenzial versprach.
Er beschäftigte sich mit Kokain, weil es damals als vielversprechendes Medikament galt. Die gesundheitlichen Risiken und das Suchtpotenzial waren zu dieser Zeit noch nicht umfassend erforscht.
"Über Coca"
In den frühen 1880er Jahren war Freud kein berühmter Psychoanalytiker, sondern ein junger Assistenzarzt am Wiener Allgemeinen Krankenhaus.
Er suchte nach wissenschaftlichen Themen, mit denen er sich profilieren konnte.
Erst 1883/1884 stieß er auf Berichte über Kokain und begann, sich intensiv damit zu beschäftigen. 1884 veröffentlichte er die Arbeit Über Coca, in der er euphorisch über die positiven Effekte der Substanz schrieb.
Seine Begeisterung für Kokain führte dazu, dass er es in mehreren Publikationen als Mittel gegen Müdigkeit, Schmerzen und sogar Morphiumsucht empfahl.
Freud hat selber Kokain konsumiert
Im 19. Jahrhundert war es unter Ärzten üblich, neue Substanzen am eigenen Körper zu testen – auch Freud machte da keine Ausnahme und probierte Kokain selbst.
Zwischen 1884 und 1896 nutzte Freud Kokain vermutlich regelmäßig gegen diverse Schmerzen oder Stimmungsschwankungen (dies geht aus seinen persönlichen Briefen hervor, in denen er dies erwähnt).
Ein bedeutender Fehler
Sein Freund, Fleischl-Marxow, litt an einer schweren Morphiumsucht, und Freud hoffte, dass Kokain als Substitutionsmittel helfen könnte. Dies erwies sich als fatale Fehleinschätzung: Fleischl-Marxow entwickelte eine starke Kokainabhängigkeit, zusätzlich zur bestehenden Morphinsucht und verstarb schließlich an den Folgen seines Substanzmissbrauchs. Freud sprach sich später nicht mehr für den medizinischen Einsatz von Kokain aus. 1887 warnte er in einem Nachtrag zu einem Fachartikel vor den Risiken – Noch bevor sein Freund Fleischl-Marxow dann 1891 an den Folgen einer kombinierten Morphin- und Kokainabhängigkeit starb.
Die Entstehung der Psychoanalyse
Seine zentralen Theorien, darunter das Konzept des Unbewussten und die Traumdeutung, entstanden in einer späteren Phase seines Schaffens, als Kokain in seiner profesionellen Arbeit keine große Rolle mehr spielte.
1895 veröffentlichte er mit Breuer Studien über Hysterie, den Grundstein der Psychoanalyse. 1900 folgte Die Traumdeutung, sein erstes großes Werk zur Theorie des Unbewussten. Seine zentralen Theorien – etwa über psychosexuelle Entwicklung (1905) oder das Strukturmodell von Ich, Es und Über-Ich (1923) – entstanden nach seinen Kokainexperimenten bzw. Empfehlungen.
Jaja, aber hat er Kokain konsumiert, während er die Psychoanalyse entwickelte?
Möglich wärs. Vielleicht hat er beim Schreiben von der "Traumdeutung" Nasensport betrieben, sich sozusagen am Wiener Schneefall erfreut.
Für mich persönlich relevant:
Es gibt keine Belege dafür, dass Freud seinen Patienten im Rahmen der Analyse Kokain empfahl – und die Substanz wurde auch nie Teil seiner Methode oder Theorie. Ob er aber beim Schreiben heimlich nachgeholfen hat oder später privat konsumierte? Das bleibt also Spekulation – und Teil der Freud-Legende.
Interessante und kritische Links dazu:
Daiber, J. (2018). Therapeutisches Scheitern: Freud, das Kokain und die Literatur. In Hofmannsthal Jahrbuch zur Europäischen Moderne (Bd. 26, S. 261–307). Erich Schmidt Verlag. https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/48316/file/HJb_26_2018_261_307.pdf
Sheppard, R. (2019). Freud: The man, the scientist, and the birth of psychoanalysis. Welbeck Publishing Group.
Oliver, S. (n.d.). How Cocaine Influenced the Work of Sigmund Freud. VICE. https://www.vice.com/en/article/how-cocaine-influenced-the-work-of-sigmund-freud
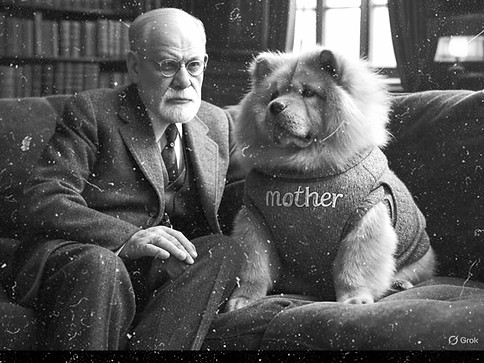
Freuds Psychoanalyse ist unwissenschaftlich!
Für alle Kurzangebundenen:
Freud ist nicht evidenzbasiert. Aber das sind viele psychologische Theorien auch nicht.
Das ist nicht schlimm – solange man weiss:
Es geht nicht um Wahrheit, sondern um Perspektiven.
Ich gebe Ihnen recht. Freuds Theorien genügen nicht den heutigen Kriterien wissenschaftlicher Evidenz.
In einem peer-reviewten Blättchen würde er den Penisneid wohl heute nicht publizieren können.
Aber seine Theorien sind auch nicht blosse Fantasie, die sich ein jeder gerade mal so hätte ausdenken können. Ein Schlangenölverkäufer ist Freud nämlich nicht – lassen Sie mich das etwas ausführen, bevor Sie nachher wieder weiter Ihren Tagträumen von randomisierten Stichproben nachhängen.
Im Glashaus sitzend
Ich gehe mit Ihrem Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit Freuds mit und lege noch einen drauf:
Die klinische Psychologie, insbesondere die Störungsdiagnostik (ICD oder DSM), schmeisst mit Steinen und schreit: „Psychoanalyse, pfui! Unwissenschaftlich!!“ – und sitzt doch selbst im Glashaus der Scheinwissenschaft.
So wirkt die klinische Psychologie auf mich wie der kleine, unbeliebte Bruder der älteren Schwester – der Humanmedizin.
Er drängt sich auf die Party der Grossen und man lässt ihn gewähren – nicht, weil er überzeugt, sondern weil man eine gewisse Verwandtschaft nicht ganz leugnen kann und die grosse Schwester nicht brüskieren möchte.
„Scheinwissenschaft?“, denken Sie vielleicht düpiert.
Ja, man beruft sich gerne auf Objektivität, Messbarkeit und wissenschaftliche Strenge – und ahmt damit implizit den Habitus der Naturwissenschaften nach, um sich zu legitimieren. Doch die diagnostischen Kategorien in der klinischen Psychologie beispielsweise beruhen nicht auf objektiv messbaren biologischen Markern, sondern auf Symptombeschreibungen, die per Expertenkonsens definiert werden – ohne gesicherte Kausalmodelle.
Bis heute gibt es zum Beispiel keinen einzigen klinisch anerkannten Biomarker für psychische Störungen ( Biomarker = Objektive Messgrösse im Körper).
Zurück zu Freud
Seine Theorien und Modelle sind nicht nachweisorientiert – sie sind hermeneutisch: deutend, nach Sinn suchend. Sie entstanden auf der Grundlage seiner intensiven klinischen Beobachtung und Praxis.
Als Arzt behandelte er über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Patienten und führte eine Selbstanalyse durch, schloss dann auf die menschliche Psyche im Allgemeinen. Er schien hierbei eine grosse Begabung zur Mustererkennung zu besitzen.
Freud entwickelte nicht einfach eine Theorie über Symptome (Angst, Narzissmus, Hysterie usw.).
Er entwickelte eine komplette Denkarchitektur:
Er erklärte die Psyche nicht punktuell, sondern im Ganzen.
Vom Vatermord im Beginn der Zeit, über Traum und Neurose. Konflikte und Triebe. Lust und Liebe, die Frage, was das «Ich» ist.
Ob man das für grössenwahnsinnig hält oder für genial, ist Ihnen, lieber Leser, selbst überlassen.
„Also“, werden Sie vielleicht denken, „Freud entwarf Denkmodelle und Theorien. Schön. Aber warum sollten wir auf Modelle zurückgreifen, wenn wir evidenzbasierte, nachgewiesene Forschung haben? Und warum ausgerechnet Freud – aus dem Jahr 1910?“
Weil Modelle und Theorien in der Psychologie unabdingbar sind. Weil „sauberes Messen“ in vielen Fällen schlicht nicht möglich ist. Subjektives Erleben und Verhalten lassen sich nur schwer messen – nicht wie etwa Geschwindigkeit, Masse oder Blutzuckerwerte.
Begriffe wie Angst, Trauma oder Narzissmus, Glück wirken auf den ersten Blick klar – sind sie aber mehrdeutig, je nach Mensch, Kultur, Zeitgeschichte.
Was meinen wir denn genau, wenn wir „Angst“ sagen? Etwas Biologisches? Etwas Gelerntes? Eine unbewusste Abwehr? Ein Gefühl? Ist es eine Reaktion – oder bereits ein Symptom?
Beim reinen Beschreiben und Kategorisieren des Phänomens (z. B. Angst) mag es noch einen gewissen Konsens geben, aber beim warum jemand Angst hat, wozu Angst dient, wieso Angst entsteht und ob und wie sie zu behandeln sei, unterscheiden sich die Theorien massiv – und das ist gut so.
Es zeigt, dass es verschiedene Menschen gibt, die die Welt verschieden erklären (deuten).
Ob man 2025 zur Klärung obenstehender Fragen noch Freuds Theorien heranziehen sollte, ist eine andere Debatte.
Maslows Pyramide
Denkmodelle und Theorien kennen und nutzen wir innerhalb der psychologischen Disziplin übrigens rege.
Hier einige Müsterchen, die Ihnen vielleicht bekannt sind:
Maslow (Bedürfnishierarchie),
Erikson (psychosoziale Entwicklungsstufen),
Rogers (personenzentriertes Selbstkonzept),
Jung (Archetypen, Heldenreise),
Adler (Minderwertigkeitskomplex),
Beck (kognitives Modell der Depression),
Engels biopsychosoziales Modell,
Lewin mit seiner Feldtheorie – und selbst Grawe mit dem Konsistenzmodell.
Alles wichtige Erkenntnisse, bei denen fehlende Evidenz aber kaum moniert wird.
(Übrigens: Nicht replizierbare sozialpsychologische Experimente wie das Stanford-Prison-Experiment, Priming-Experimente oder Milgrams Gehorsamsexperiment werden auch nicht wissenschaftlicher, je öfter man sie in Podcasts, Büchern und Psychologievorlesungen erwähnt.)
Wieso wird also Freud stark kritisiert, während man Maslows Pyramiden jedem Schüler in den Schädel hämmert – ohne „Kritik“, ohne „Einordnung“?
Das hat – aus meiner Sicht – auch sehr nachvollziehbare Gründe:
1. Psychopathologie
Wer erklärt, warum Symptome entstehen, hat Macht. Freud nahm sich diese – und konnte damit auch stigmatisieren.
Er beschrieb nicht nur, was ein Symptom ist, sondern auch, woher es kommt – etwa: Hysterie als Folge verdrängter Sexualität, Angst als Reaktion auf ein inneres Verbot, Neurose als Fixierung libidinöser Energie auf ein früheres Entwicklungsstadium.
Moderne Ansätze entschärfen das «Woher?», indem sie sich auf multikausale Modelle berufen – und damit alles und nichts zugleich meinen.
Bei Freud geht es nicht um praktische Kommunikationstipps für Managementseminare („Man kann nicht nicht kommunizieren!“).
Psychopathologie – also die Lehre über psychische „Störungen“ – ist ein ethisch heikler Bereich, in dem normiert, klassifiziert und beurteilt wird.
Da holt man zurecht die kritischere Brille raus.
Die Geschichte der Psychiatrie lehrt uns: Mit Diagnosen, Ätiologie (dem „Woher?“ und „Warum?“) und Therapien geht Macht, Verantwortung und ein enormes Missbrauchspotenzial einher.
Ein aktuelles Beispiel gefällig? In der ICD-10 galt Transidentität noch als psychische Störung (Geschlechtsidentitätsstörung). Heute, rund 30 Jahre später, ist sie in der ICD-11 als Geschlechtsinkongruenz im Kapitel „Sexuelle Gesundheit“ und wird nicht mehr als eine Störung gesehen.
2. Selbstinszenierung
Sie macht ihn – damals wie heute – angreifbar.
Freud hat seine Theorien als wissenschaftlichen Zugang vorgestellt, nicht als mögliche daraus ableitbare Modelle.
Freud, selbst Arzt, verstand sich als (Natur-)Wissenschaftler.
Seine „Beweisführung“ wurde allerdings schon zu seinen Lebzeiten stark kritisiert (Gedächtnisprotokoll seiner Sitzungen, zu subjektiv ausgewertete Fallvignetten, keine Systematisierung bei der Aufzeichnung …).
Dass Freud seine Theorie medizin-nah positionierte – inklusive (an die Physik angelehnten) Energiebegriffen und nahezu mechanistischen Erklärungen des psychischen Apparats – macht sie ebenfalls angreifbar.
Und seine Theorie ist elegant aufgebaut, sodass sie nicht widerlegbar ist.
Vereinfacht: Sie lieben Ihre Mutter? Nein? Dann verdrängen Sie, dass Sie sie lieben.
3. Sex sells?
Der Streit um die Deutungshoheit von „gesund“ und „krank“ ist, wie bereits erklärt, ein Machtinstrument.
Und was Freud sagte, war gefährlich, kränkend für unsere Spezies.
Lässt man die berechtigte methodische Kritik beiseite, bleibt: Seine Theorien sind einfach inhaltlich unbequem.
Während Maslow, Seligman oder auch Jung dem Menschen schmeichelnde Modelle entwarfen, brachte Freud das, was am meisten kränkt:
Er unterstellt dem Menschen nicht nur Kontrollverlust – sondern auch Schuld, Trieb, Lust, Abgründigkeit.
Nichts darf mehr bloss nett, vernünftig oder altruistisch sein.
Alles wird potenziell aufgeladen: mit Begehren, Eifersucht, Rivalität, Schuld, Spannung. Selbst das harmloseste Verhalten wird suspekt, wenn man es mit der freudschen Lupe betrachtet: Der Blick zum Vater.
Die Berufswahl. Der Witz. Der Versprecher. Der Traum. Nichts bleibt unverdächtig. Alles ist – in letzter Konsequenz – sexuell kontaminiert. Und das kratzt.
Am Selbstbild. Gerade in Zeiten, in denen man sich lieber als reflektiertes, aufgeklärtes, souveränes Wesen inszeniert. Freud zerstört genau diese Inszenierung.
Er sagt: Der Mensch ist nicht einfach ein bisschen emotional. Er ist strukturell widersprüchlich.
Nachdem wir uns nun darauf geeinigt haben, dass es – in psychologischen Belangen – Theorien und Modelle gibt und geben muss, um Komplexität zu reduzieren, stellt sich für mich nicht so sehr die Frage, welche davon sich durchgesetzt haben, welche Face Validity (augenscheinliche Plausibilität) aufweisen oder welche freudschen Konzepte heute noch tragfähig sind.
Viel eher interessiert mich:
Welche Theorie, welches Weltbild (welche Ideologie), wählen wir aus, um uns die Psyche zu erklären?
Und lassen Sie sich nicht hinreissen zu sagen:
„Das sei doch völlig klar – dasjenige sei das logischste, naheliegendste Konzept.“ Für Sie vielleicht. Für jemand anderen ist dasselbe Unsinn, vereinfacht oder abstrakt.
Oder Sie denken:
„Ich halte mich an die Evidenz, an den wissenschaftlichen Konsens“ –
dann gratuliere ich: Sie haben sich ebenfalls für ein von Ideologie durchdrungenes Weltbild entschieden. Wagen Sie ruhig einen Blick auf den wissenschaftlichen Konsens vergangener Jahrzehnte in der Psychiatrie. (Žižek lässt grüssen.)
Lässt uns also die Idee von Empirie, Laborkitteln und Statistiken gut einschlafen?
Befriedigen uns – wörtlich? – Freuds Theorien?
Fühlen wir uns bei Rogers verstanden?
Bei Jung mystisch aufgehoben? In der Positiven Psychologie ermächtigt?
Erklär mir die Welt
Was uns überzeugt, was uns anspricht, wem wir die Kompetenz zusprechen,
verrät oft mehr über unsere Wünsche und Ängste
als über die Gültigkeit der Theorie selbst.
Wer also nach dem „wahren“ Erklärungsmodell sucht, hat wohl schlechte Karten.
Das gewählte Modell sagt – klammheimlich – etwas über unser Begehren:
darüber, was wir uns erhoffen,
was wir vermeiden wollen,
worauf wir lieber nicht so genau schauen –
und was wir vom „anderen“ erwarten oder er von uns.
Und natürlich – seien wir nicht naiv –
einmal gewählt, werden wir unseren Erklärungsansatz überall in der Welt bestätigt sehen.
Sehen Sie,
das liesse sich jetzt wunderbar weiter freudianisch analysieren.
Aber nehmen Sie sich in Acht: Wer sich – wie ich – einmal auf die Quacksalber-Theorien des werten Kollegen Sigismund Schlomo Freud einlässt, sieht bald überall nur noch ödipale Komplexe lauern. Penisneiderinnen, wohin man blickt; kastrationsängstliche Jünglinge –
und Träume, die kaum entblättert, wahlweise zur Mutter, zum Vater, zu etwas Unanständigem – oder allen dreien zugleich – führen.
Interessante und kritische Links dazu:
Deutsche Aidshilfe. (o. J.). ICD‑11: WHO wertet Trans nicht mehr als „mental gestört“*. https://www.aidshilfe.de/de/meldung/icd-11
World Health Organization. (n.d.). Gender incongruence and transgender health in the ICD. WHO. https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gender-incongruence-and-transgender-health-in-the-icd
Insel, T. R., & Cuthbert, B. N. (2025). Toward a biologically informed framework for psychiatry. Molecular Psychiatry.
https://doi.org/10.1038/s41380-025-03070-5
Lee, Y. Y., Wang, L. J., & Yen, C. F. (2025). Identification of diagnostic and therapeutic biomarkers for attention‑deficit/hyperactivity disorder. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 41(3), 187–196. https://doi.org/10.1002/kjm2.12931
Kauders, A. D. (2014, 6. März). Psychoanalyse: Warum Zeitgenossen Freuds Lehre kritisierten. Spektrum der Wissenschaft. https://www.spektrum.de/magazin/psychoanalyse-warum-zeitgenossen-freuds-lehre-kritisierten/1240985
Töpfer, K. (2024, 18. September). Psychoanalyse: Warum Zeitgenossen Freuds Lehre kritisierten. Spektrum der Wissenschaft. https://www.spektrum.de/magazin/psychoanalyse-warum-zeitgenossen-freuds-lehre-kritisierten/1240985
Wikipedia. (o. J.). Decline and fall of the Freudian Empire. In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Decline_and_Fall_of_the_Freudian_Empire